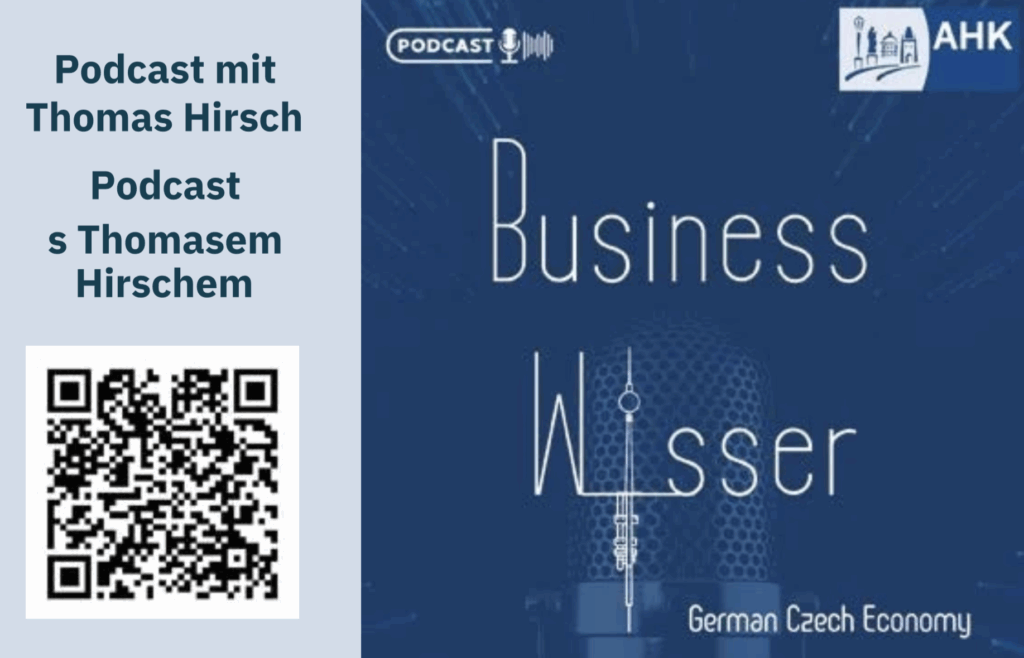„Wir mussten lernen zu vergessen, wie wir bisher gearbeitet haben“
Interview mit Thomas Hirsch, CEO vom Zulieferer HIRSCH Technologies
Die Automobilindustrie steckt in der Dauerkrise, während die Rüstungsindustrie boomt und schnell neue Kapazitäten aufbaut. Viele Zulieferer suchen deshalb Chancen im Rüstungssektor.
Das mittelständische Hightech-Unternehmen HIRSCH Technologies aus Eichstätt entwickelt seit 2016 Komplettlösungen und stellt hochpräzise Bauteile und Baugruppen her, zuerst für Automotive, heute auch für die Rüstungsindustrie. Stichwort: Dual-Use, Technologien, die im zivilen wie im militärischen Bereich einsetzbar sind.
Geschäftsführer Thomas Hirsch steht für eine neue Unternehmergeneration, technologieorientiert, international vernetzt und offen, die Grenzen zwischen klassischen Industrien und sicherheitskritischen Branchen zu überwinden.
Thomas Hirsch, geben Sie uns eine Vorstellung davon, was Ihr Unternehmen HIRSCH Technologies entwickelt und verkauft.
Wir entwickeln nicht nur, wir stellen auch noch etwas Wirkliches her. Wir sehen uns als Möglichmacher, Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister, und liefern mechanische Präzisionsteile und Baugruppen für die Bereiche Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung. Das Know-how haben wir ursprünglich aus dem Anlagen- und Maschinenbau für die Automobilindustrie aufgebaut und seit 2020 auf sehr radikale und inspirierende Art und Weise transformiert.
„Auf sehr radikale und inspirierende Art und Weise transformiert“
Sie haben als Unternehmer 2010 bei Null angefangen, 2016 war dann ein entscheidender Wendepunkt.
Genau, die Story beginnt, als ich mit 21 Jahren im Nebengewerbe mein erstes Unternehmen gegründet habe mit Konstruktions- und Entwicklungsdienstleistungen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau der Automobilindustrie. Und so habe ich mir ein Startkapital erwirtschaftet, mit dem ich dann 2016 die damalige Hirsch Engineering Solutions GmbH & Co. KG gegründet habe und als Ein-Mann-Betrieb durchgestartet bin. So ist über die letzten neun Jahre ein Unternehmen entstanden, das heute unter HIRSCH Technologies firmiert, 30 Mitarbeiter beschäftigt und für Technologie-Pioniere nicht mehr nur in Deutschland arbeitet.
Wie und wann ist der Shift von der Automobilindustrie in Richtung Rüstungsindustrie passiert?
Der Fokus hat sich erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Wir waren hier vor den Toren Ingolstadts viel in der verlängerten Werkbank für die Automobilindustrie tätig, und es herrschte noch Hochkonjunktur. Da haben wir als kleines Unternehmen bereits damals eine Menge Know-how aufgebaut, investiert und sind gewachsen. Aber durch die Corona-Krise ist dann sehr viel weggebrochen.
Und das haben wir uns zum Anlass genommen, um nach vorne zu schauen, unser Geschäftsmodell weiterzudenken. Auf Basis der Hightech-Agenda Bayern haben wir angefangen unsere Fühler auszustrecken und es dann tatsächlich geschafft, als einer der ersten Lieferanten für das Bayerische Raumfahrtprogramm tätig zu werden. Diese Transformation hat dazu geführt, dass wir dann auch frühzeitig in den wehrtechnischen Sektor einsteigen konnten. Dafür besitzen wir heute die entsprechenden Zertifizierungen und Zulassungen, um nicht nur in der Entwicklung tätig zu sein, sondern auch Serienprogramme begleiten zu dürfen.
Also eine aus der Krise geborene strategische Entscheidung. Welche Technologien und Prozesse aus dem Automotive-Bereich ließen sich 1 : 1 übertragen, und wo mussten Sie dann völlig neu denken?
Dadurch, dass wir die entsprechenden Systeme nicht nur für die Konstruktion, sondern auch für die Berechnung verschiedenster Varianten zur Verfügung haben, war es relativ einfach, das Know-how zu transformieren. Wir mussten uns aber auf ganz andere Anforderungen und Spezifikationen einlassen, die im militärischen Sektor zum Einsatz kommen. In der Produktion war die Herausforderung dadurch noch mal ganz anders, dass wir angefangen haben, mit Werkstoffen zu arbeiten, die wir teilweise noch gar nicht kannten. Wir haben sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, um die ganzen Standards erfüllen zu können.
Es geht vor allem um Dokumentation, Nachweispflichten, im Rahmen der Zertifizierung EN 9100…
Richtig, dafür mussten wir das Unternehmen auf den Kopf stellen. Wir mussten quasi lernen zu vergessen, wie wir bisher gearbeitet haben, um uns neu auszurichten für die Anforderungen dieser Branchen.
Welche Schritte mussten Sie dafür gehen, um diese Zertifizierung zu bekommen?
Es sollte rund zwei Jahre dauern, bis wir diese Zertifizierung in der Tasche hatten, die ja mehrere Prozessschritte mit sich bringt und erfordert, das Unternehmen eigentlich redundant aufzustellen: nicht nur alle Prozesse niederzuschreiben, sondern auch dafür zu sorgen, dass die sehr hohen Standards, dann auch nachhaltig vom Unternehmen erfüllt werden. Zunächst geht es darum, dass wir ein gemeinsames Verständnis als Unternehmen haben, für welche Technologien, Bereiche und Kunden wir tätig sind. Das heißt sensibilisieren, sensibilisieren, sensibilisieren, damit am Ende die Qualität zu 100 % passt.
Keine Kompromisse, wenn es um sicherheitskritische Bauteile geht, und das muss in erster Linie in den Köpfen der Leute ankommen. Es erfordert eine passende Infrastruktur und einen langen Atem, diesen Weg dann auch zu Ende zu gehen. Das ist für ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden schon eine echte Herausforderung während des laufenden Tagesgeschäfts. Aber es hat auch dazu geführt, dass wir dieses Unternehmen geworden sind, das wir werden wollten, und hat uns bis zum heutigen Tag sehr viele Türen geöffnet.
Stichwort „Kundenorientierung“: Wie unterschiedlich ticken eigentlich Automotive-Kunden und Defence-Kunden?
Das wäre wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das eine hat nicht mehr wirklich mit dem anderen etwas zu tun. Im militärischen Kontext haben wir überwiegend mit ehemaligen Soldaten zu tun, die als Projektleiter in den Systemhäusern, Startups oder Unternehmen tätig sind. Und das war für uns als Maschinenbauer, die alle irgendwo aus der Automobilindustrie kommen, schon ein Lernprozess, was die Kommunikation und den Umgang mit den Kunden betrifft.
„Ein Lernprozess, was die Kommunikation und den Umgang mit den Kunden betrifft“
Geben Sie mal ein Beispiel …
Als ich im Jahr 2023 bei einer wehrtechnischen Veranstaltung in Bonn zu Gast war, saß bei der Abendveranstaltung neben sieben Panzergrenadieren ein Maschinenbautechniker am Tisch. Und das war ich. Und habe ich festgestellt, dass die untereinander ein ganz anderes Wording haben, ein ganz anderes Verständnis von dem, wie es auf dem Gefechtsfeld zugeht, wie es auch in den Unternehmen zugeht.
Mich hat das dazu motiviert, zunächst einmal zuzuhören. Was treibt denn die Menschen, die diesen Hintergrund haben, eigentlich um? Was ist deren persönliche Mission? Und was ist der Beitrag, den wir als Unternehmen leisten können? Die Bundeswehr braucht die wehrtechnische Industrie, um sie mit den besten Systemen ausstatten zu können, und die wehrtechnische Industrie braucht Lieferanten, Möglichmacher im Hintergrund, die diese Themen entwickeln und als fester Bestandteil der Lieferkette agieren.
Viele Automotive-Zulieferer haben die Vorstellung, dass sie relativ unkompliziert eines ihrer Produkte auch im Rüstungssektor verkaufen können …
Das eigene Produkt oder Portfolio einfach nur verkaufen zu wollen, wird nicht zielführend sein. Eine entscheidende Frage ist: Wer ist denn eigentlich der Kunde, die Bundeswehr oder die wehrtechnische Industrie? Es ist Zuhören erforderlich. Es ist erforderlich, Nischen und Lücken zu erkennen und die mit dem eigenen Know-how zu füllen. Und das erfordert in den meisten Fällen eine Transformation.

Können Sie uns ein konkretes Beispiel für so ein Dual-Use-Produkt, eine Technologie geben, die sowohl im Auto als auch im Rüstungsprodukt anwendbar ist?
Das ist aufgrund von Geheimordnungsvereinbarungen relativ schwer da offen zu sprechen. Als Zulieferer im Hintergrund können wir oftmals auch gar nicht beurteilen, welche Technologie jetzt rein zivil oder rein militärisch eingesetzt wird. Aber zum Beispiel im Bereich der Drohnen oder der Trägerraketen ist ja klar, dass da ganz viel Dual-use ist, für militärische Satelliten oder zur Klimabeobachtung.
Haben Sie für Ihre Transformation eine hilfreiche Infrastruktur vorgefunden im unternehmerischen Umfeld und ausreichend Unterstützung bekommen von der Politik oder auch den Industrie- und Handelskammern, um solche Schritte zu ermöglichen oder Netzwerke aufzubauen?
Wir sind diese Themen noch vor dem Ukrainekrieg angegangen, da waren die Herausforderung Kontakte oder Netzwerke zu knüpfen deutlich größer als es heute ist. Heute erkennen das eigentlich alle Branchenverbände, die IHKs, die AHKs. Es finden laufend Netzwerkveranstaltungen, Informationsveranstaltungen statt. Das Wirtschaftsministerium tut auch sehr viel dafür, dass sich Zulieferer, die überwiegend aus der Automobilindustrie kommen, informieren, vernetzen und transformieren können.
Die Banken allerdings müssen sich noch deutlich mehr öffnen, weil sie das Geschäftsmodell Bundeswehr oder Verteidigungsindustrie noch nicht verstehen, wenn sie über die letzten 30 Jahre nur die Automobilindustrie kannten.
„Die Banken allerdings müssen sich noch deutlich mehr öffnen“
Sie waren als Mitglied einer Unternehmerdelegation des BDI 2024 auch in der Ukraine. Welche Erkenntnissen hat Ihnen das gebracht?
Wir waren drei Tage in Kiew vor Ort. Für mich persönlich war das eine Spiegelwelt, die ich da betreten habe. Zum einen die Erkenntnis, dass das nicht weit weg ist von Deutschland. Man wird permanent mit Raketen- und Luftalarm konfrontiert, muss sich in Sicherheit bringen. Man sieht, was das mit den Menschen dort macht, die sich dadurch nicht den Lebensmut nehmen lassen. Und klar wurde auch, dass wir uns technologisch gar nicht schnell und gut genug aufstellen können, so dass wir im Falle des Falles auch verteidigungsfähig sind.
Und für mich persönlich war das eine sehr wertvolle Reise, weil sich mein „Military Mindset“ auf ein anderes Niveau gehoben hat, das bei uns hier in Deutschland noch nicht so ganz angekommen ist, anders als in den baltischen Ländern beispielsweise.
Herr Hirsch, Sie kommen nach Prag und sprechen am 11. November auf unserem German-Czech Economic Forum 2025. Wie wichtig ist die internationale Zusammenarbeit für Ihr Geschäft?
Wir müssen eine starke innereuropäische Gemeinschaft vor allem im wirtschaftlichen und im verteidigungstechnischen Sektor schaffen. Daher ist es ungemein wichtig, mit Partnerländern zu kooperieren. Und so haben wir jetzt auch im Rahmen des European Defence Fund das eine oder andere Projekt, das mit mehreren EU- und NATO-Partnern zusammen verwirklicht wird. Und da passiert vieles aus Deutschland heraus. Mit Tschechien sind wir direkte Nachbarn, von daher freue ich mich sehr auf die Veranstaltung im November, auf bilaterale Gespräche, auch was die Dual-use-Themen betrifft, und auf Anknüpfungspunkte für neue Kooperationen.
Foto quellen: Archiv Thomas Hirsch